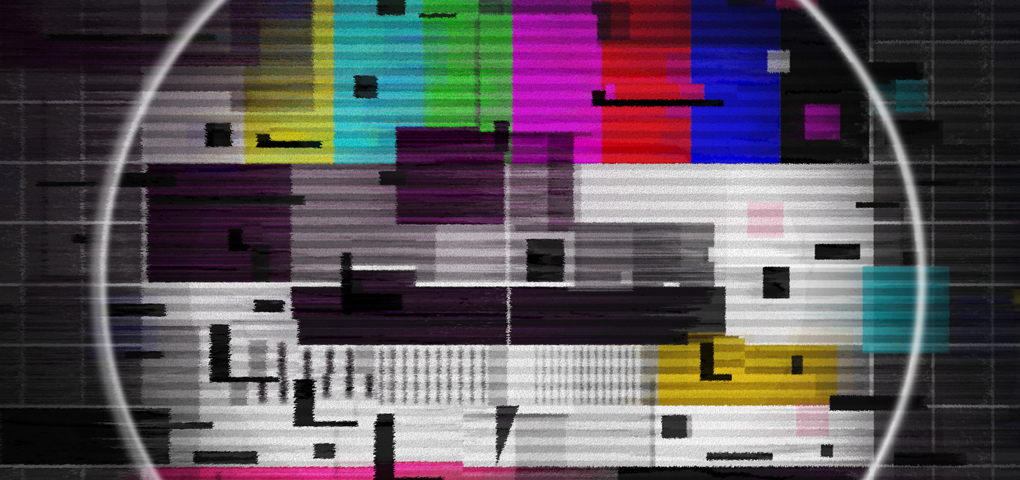Ich bin 22 Jahre alt und Studentin. Ich liebe den Kontakt zu Menschen und habe eine soziale Angststörung. Seit drei Jahren ist die Angst mein ständiger Begleiter und ich stets auf der Hut. Als sich die Panikattacken zu häufen begannen, bekam ich Angst vor dieser Angst und irgendwann Depressionen vor lauter Panik. Ich habe angefangen, mich zurückzuziehen, soziale Kontakte zu meiden und mich für diese vermeintliche Unfähigkeit zu hassen. Ein Jahr später stand ich zum ersten Mal im Behandlungszimmer eines Psychiaters. Mittlerweile kenne ich zwei therapeutische Praxen von innen und mich selbst sehr viel besser.
Eine Panikattacke beginnt meistens, wenn ich das Gefühl habe, gefangen zu sein. Sei es in einem stickigen Raum voller Menschen oder einer angespannten Gesprächssituation. Mein Körper beginnt dann mit einer sogenannten Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Anfangs verkrampfen sich die Muskeln und meine Atmung wird flach. Die beklemmende Anspannung fühlt sich wie ein Zuschnüren der Kehle an. Mir wird warm und ich schwitze, obwohl die Zimmertemperatur für andere angenehm ist. Vergleichen kann ich das Gefühl mit einem zu langen Sprint. Man meint seinen Puls hören zu können und fühlt die eigenen Schlafen beben. In meinem Kopf entsteht ein Strudel aus Panik, der sich immer schneller zu drehen scheint, bis die Umgebung einen unwirklichen Eindruck macht und mir die Tränen in die Augen treibt. Der Raum wirkt erdrückend und unerträglich laut. Schwindel hilft mir darüber hinaus nicht unbedingt, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Aus jeder Veranstaltung, die nicht meine engsten Freunde einschloss, wurde für mich im Laufe der Zeit ein Kreativwettbewerb. Warum bist du plötzlich ohne Verabschiedung aus der Vorlesung gehetzt? Wieso schwitzt du auf einmal so stark? Wieso bist du so blass? Ich war ständig auf der Flucht und um keine Ausrede verlegen. Während meine Kollegen zusammen saßen, versuchte ich mich zu beruhigen oder verkroch mich gleich ganz zu Hause.
Ich schäme mich dafür und versuche mittlerweile offener mit meinem Handicap umzugehen, was vor allem bei offiziellen Anlässen nicht immer leicht ist. Trotzdem halte ich das für den besseren Weg. Denn es ist sehr viel unangenehmer, eine Panikattacke verheimlichen zu wollen, als mit offenen Karten zu spielen. Ich habe damit viele positive Erfahrungen gemacht. Als es mir vor etwa einem Jahr besonders schlecht ging, musste ich meinen Uni-Dozenten um um eine Auszeit bitten. Mir war diese Sonderbehandlung sehr unangenehm. Zu meiner Überraschung brachte er mir aber nicht nur Verständnis entgegen, sondern erzählte mir in einem sehr intimen Gespräch von einer Zeit, in der er selbst mit ganz ähnlichen psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Das war sehr bewegend.
Als ich zum ersten Mal einem Psychiater begegnete, erklärte der mir Begriffe wie Panikstörung, soziale Angststörung und Depression. Einen Namen für diese Gefühle zu haben, war eine große Erleichterung und der Anstoß, eine Therapie zu beginnen. Nach einer anfänglich medikamentösen Behandlung, setzte ich die Verhaltenstherapie ohne Tabletten fort und wechselte später in eine tiefenpsychologische Praxis. Anfangs war ich verzweifelt und deshalb ungeduldig, so dass es mich unheimlich frustrierte, nicht nach jeder Sitzung einschneidende Fortschritte zu sehen. Im Rückblick erstaunt es mich umso mehr, wie viel sich verändert hat. Ich habe viel über meine Krankheit und noch mehr über mich selbst gelernt. Je intensiver ich mich mit möglichen Auslösern, Konsequenzen und meiner eigenen Rolle beschäftige, desto seltener werden die Panikattacken und desto erträglicher die depressiven Phasen dazwischen.
Mittlerweile geht meine Therapie in die letzte Runde. Die schlechten Tage sind selten geworden und ich komme mit ihnen zurecht. Es wird sicher noch eine Weile dauern bis aus Seltenheit völlige Absenz geworden ist, aber ich habe durch die Therapie gelernt, diesen Rückschlägen angemessen zu begegnen und mich selbst anzunehmen. Es ist eine interessante Reise, sich selbst zu beobachten und ganz intensiv jeden Fortschritt wahrzunehmen. Für die Zukunft wünsche ich mir, wieder fröhlicher und offener zu werden und mich in meiner Lebensfreude nicht mehr in diesem Maße einschränken zu lassen.
Ist 1958 in Hofheim geboren. Mit 20 Jahren begann er sein Studium der Humanmedizin zunächst in Bochum, später in Frankfurt und Erlangen. Von 1984 bis 1995 arbeitete er als akademischer Rat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen: Psychiatrie, Neurologie inklusive Intensiv neurologie und Psychosomatik. Von 1995 bis 2007 war er Chefarzt der Psychosomatischen Abteilung in der Median Klinik Berggießhübel bei Dresden. Von 2007 bis 2014 war er Ärztlicher Direktor an der Heinrich- Heine Klinik Potsdam, seit 2014 ist er Chefarzt der Parkklinik Heiligenfeld und stellvertretender Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken.